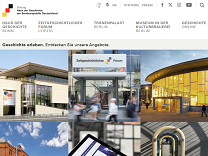LeMO-Objekt: Sitzungstisch des "Zentralen Runden Tisches" https://www.hdg.de/lemo/bestand/objekt/alltagskultur-runder-tisch.html
Der Sitzungstisch gehörte zum Mobiliar des am 7.12.1989 eingerichteten
In Ost-Berlin finden sich Mitglieder von Oppositionsgruppierungen und Mitglieder