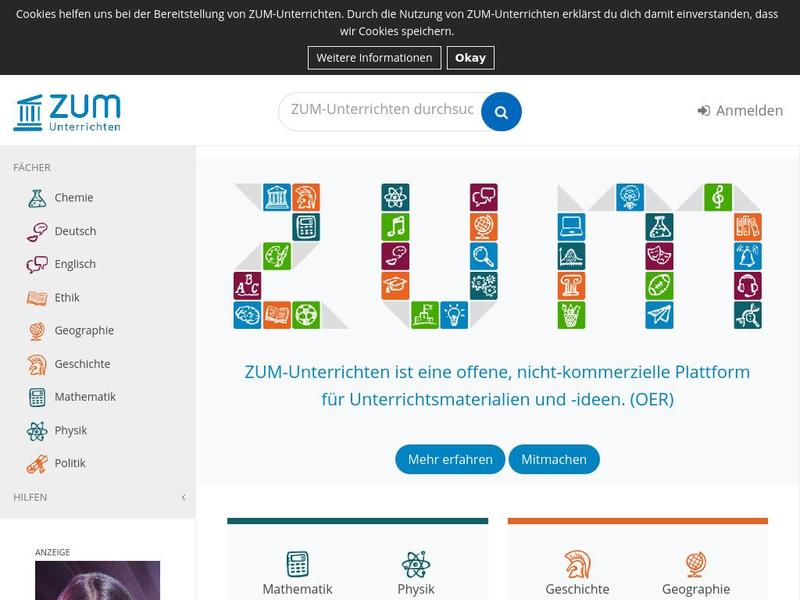An der Erdoberfläche, dort wo Wind und Wetter an der Erdrinde nagen, hat sich im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende eine Verwitterungsschicht gebildet, welche zur Lebensgrundlage aller Landbewohner, Pflanzen, Tiere und Menschen geworden ist. Diese zwischen dem Erdgestein und der Luft liegende, Leben erfüllte Schicht der Erde nennen wir Boden. Je nach Ausgangsgestein, geographischer Lage, Klima, Wassereinfluss, Bewuchs, Tiergemeinschaft und nicht zuletzt unter dem Einfluss des Menschen haben sich vielfältige Böden entwickelt. Was allen Böden gemeinsam ist, das ist ihr Anteil an Mineralien, Humus, Bodenlebewesen, Luft und Wasser.
Plattengussverfahren Bakterienkeimzahl Bodenpilze Kohlenstoffdioxidbildung Regenwurm