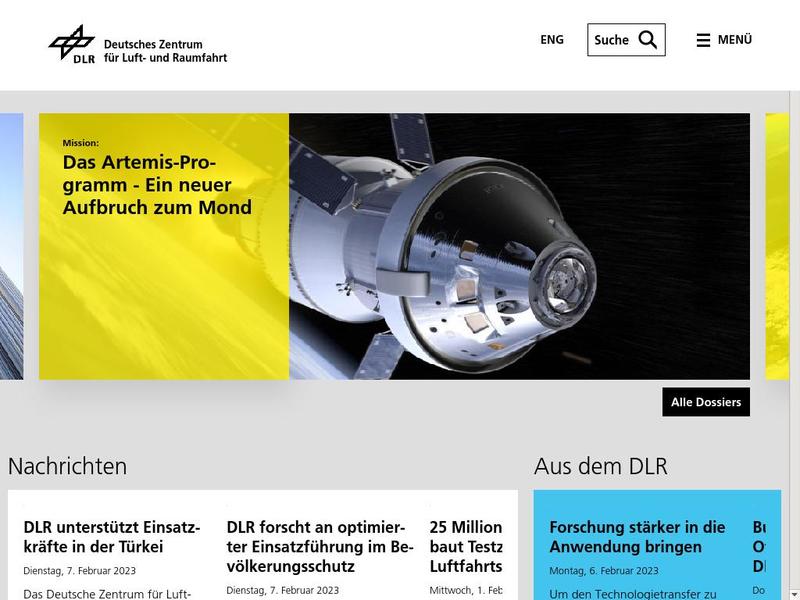Solarchemische Verfahrensentwicklung https://www.dlr.de/de/ff/ueber-uns/abteilungen/solarchemische-verfahrensentwicklung
Die Abteilung für solarchemische Verfahrensentwicklung bringt Technologien zur nachhaltigen Erzeugung von Kraftstoffen und chemischen Grundstoffen aus den Labors in die Anwendung und trägt damit substantiell dazu bei, bei energieintensiven Prozessen den Ausstoß von Treibhausgasen wie CO₂ zu reduzieren oder sogar komplett zu vermeiden.
Dabei streben wir einen Systemwirkungsgrad von 10-15 Prozent an.