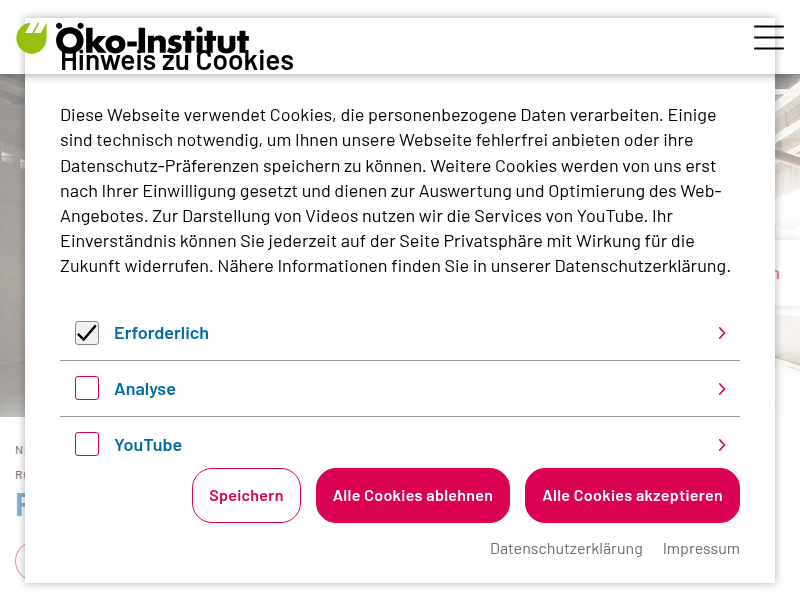Demonstrating Safety – Lessons Learnt by InSOTEC | oeko.de https://www.oeko.de/publikation/demonstrating-safety-lessons-learnt-by-insotec/?tx_form_formframework%5Baction%5D=perform&tx_form_formframework%5Bcontroller%5D=FormFrontend&cHash=5409d488acc1e8db5cb381f95be49df5
Präsentation von Beate Kallenbach-Herbert und Dr Bettina Brohmann beim OECD-NEA Symposium “The Safety Case for Deep Geological Disposal of Radioactive Waste: 2013 State of the Art”, Paris, 7 – 9 Oktober 2013. Das Projekt InSOTEC befasst sich mit der Beziehung zwischen den sozialwissenschaftlichen und technologischen Herausforderungen der geologischen Endlagerung radioaktiver Abfälle. Dabei erweitert InSOTEC den Betrachtungsumfang sozialwissenschaftlicher Forschung im Bereich der Entsorgung radioaktiver Abfälle auf den Transfer zwischen sozio-politischen Anforderungen und naturwissenschaftlich-technischen Ansätzen. Das Projekt verfolgt das Ziel, die zentralen sozio-technischen Herausforderungen herauszuarbeiten, die durch eine enge Verschränkung sozio-politischer und naturwissenschaftlich-technischer Anforderungen gekennzeichnet sind, und Möglichkeiten zum Umgang mit diesen Aspekten aufzuzeigen. Dabei sollen die folgenden Arbeitsschwerpunkte adressiert werden: (a) Identifizierung und Klärung sozio-technischer Herausforderungen bei der Implementierung der geologischen Endlagerung. (b) Vertiefte Analyse dieser Herausforderungen mittels verschiedener Fallstudien zu spezifischen Themen, bei denen das Zusammenspiel technologischer und sozio-politischer Aspekte von besonderer Relevanz ist. (c) Entwicklung und Unterstützung gemeinsamer Lernprozesse. Unterstützung von Naturwissenschaftlern und technischen Experten bei der Entwicklung von Möglichkeiten und Fähigkeiten zur Kommunikation über ihre Arbeiten und zum Austausch mit Stakeholdern über technische und sicherheitsbezogene Fragen. (d) Bereitstellung von Empfehlungen für die europäische Plattform IGD-TP zur Integration der sozio-politischen Dimension in ihre Tätigkeitsfelder, um ihre Position und ihre Positionierung gegenüber Entscheidern zu stärken.
Repository for Radioactive Waste: Experimentally Verified Radioecological Biosphere Model