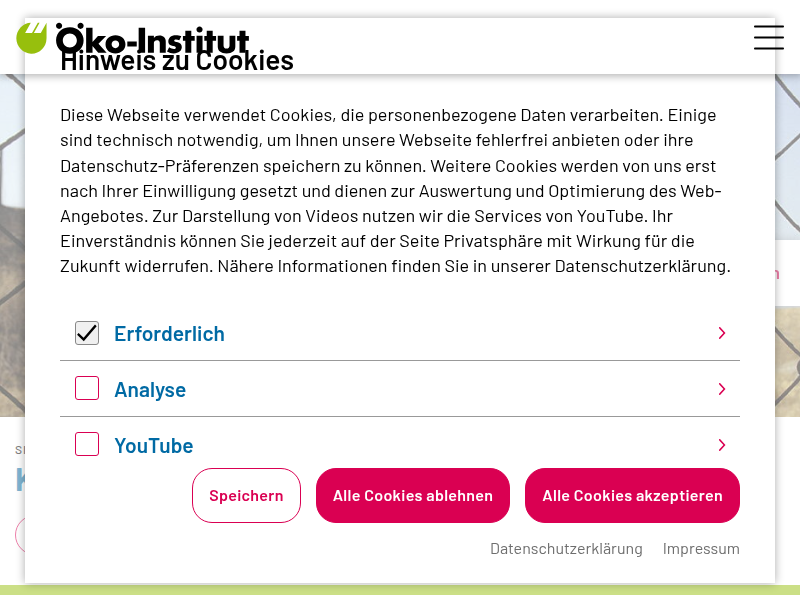Die Wärmewende kann nur gelingen, wenn viele Millionen einzelne Investitionsentscheidungen von Hauseigentümer*innen und Unternehmen so koordiniert werden, dass ein zielkonformes Wärmesystem entsteht. Für die dafür notwendige Orientierung sowie Koordination ist die kommunale Wärmeplanung das Schlüsselinstrument. Da der Bund die Kommunen nicht direkt zur kommunalen Wärmeplanung verpflichten kann, muss die rechtliche Umsetzung über die Bundesländer erfolgen. Bei der konkreten materiellen Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung bestehen Herausforderungen, u. a. in der Datenbeschaffung sowie der vertikalen Abstimmung innerhalb der Planungskaskade. Hinsichtlich Letzterer ist sicherzustellen, dass die Summe über alle lokal verfolgten Wärmewende-Strategien ein in sich stimmiges Zielbild für eine klimaneutrale Wärmeversorgung ergibt. In dem Kurzbericht sind die genannten Aspekte als Grundlage für die bundesweite Einführung einer Pflicht zur Wärmeplanung zusammenfassend beleuchtet.